Bitte verwenden Sie Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox.
Roggensauerteigbrot – Was drin steckt und wie es gebacken wird
Welche Zutaten stecken im Roggensauerteigbrot?
Damit ein Brot sich Roggenbrot nennen darf, müssen mindestens 90 Prozent Roggenmehl enthalten sein. Wie der Name schon verrät, gehört in den Klassiker ausserdem ein Sauerteig hinein, wenn am Ende ein Roggensauerteigbrot herauskommen soll. Das Ergebnis bringt einen kräftigen Geschmack und eine dunkle Farbe mit sich und ist als rundes Walliser Roggenbrot oder eckiger Pumpernickel bekannt. Bei einem reinen Roggenbrot ist der Einsatz von Sauerteig noch wichtiger als beispielsweise in Graubroten, da der Roggen im Unterschied zum Weizen andere Backeigenschaften mitbringt, die etwas Hilfe beim Aufbau eines stabilen, luftigen Teiggerüstes benötigen. Genau diese Hilfe stellt der Sauerteig zur Verfügung, den du übrigens auch ganz einfach selbst herstellen kannst.
Wie stelle ich Sauerteig mit Roggenmehl selbst her?
Sauerteig ist im Grunde eine kleine Teigmenge, in der Hefe und Milchsäurebakterien einen Gärprozess in Gang setzen.
- Die Hefe, die im Sauerteig wirkt, muss nicht von aussen zugeführt werden, sondern ist bereits in wilder, natürlicher Form im Mehl enthalten.
- Verwenden kannst du entweder Vollkornmehl oder Teilauszugsmehl (zum Beispiel Typ 1150), das mit Wasser vermengt und an einem warmen Ort mit etwa 24 bis 28 Grad gelagert wird.
- In regelmässigen Abständen reicherst du die Mischung mit weiterem Mehl und Wasser an.
- Der Sauerteig gärt nun mit sichtbaren Luftblasen und mit einem kräftigen Geruch.
- Etwa nach dem sechsten Tag ist der Sauerteig einsatzbereit und du kannst ihn bis zu drei Tage im Kühlschrank lagern.
Tipp: Du kannst eine kleine Menge der Mischung, das Anstellgut, im Kühlschrank lagern und als Starthilfe für weitere Sauerteige nutzen.
Wie lange muss der Teig für Roggenbrot aufgehen?
Nachdem du das Roggenmehl, den Sauerteig und die weiteren Zutaten vermischt hast, sollte der Vorteig idealerweise für ein bis zwei Stunden ruhen. Anschliessend formst du die Brotlaibe und lässt diesen Hauptteig noch einmal ruhen und aufgehen. Perfekt geeignet sind dabei so genannte Gärkörbchen, in denen das Brot mit einem Tuch abgedeckt seine Form und das charakteristische Rillenmuster bekommt. Wenn du lieber Brötchen fertigen willst, kannst du die Teiglinge einfach abgedeckt auf einer bemehlten Arbeitsfläche in der zweiten Runde gehen lassen.
Top Dienstleister in Zurich und Umgebung
-
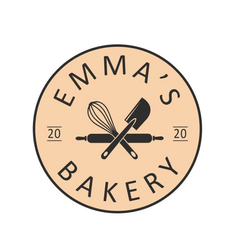 Zürich
ZürichEmma's Bakery KlG
PremiumSchaffhauserstrasse 125, 8057 Zürich0 Bewetungen043 543 20 67 0435... Nummer anzeigen 043 543 20 67 043 543 20 67 -
Zürich
St. Jakob Beck & Kafi
Viaduktstrasse 20, 8005 ZürichSt. Jakob Beck & Kafi wurde mit 4.9 von 5 Sternen bewertet4.913122 Bewetungen044 295 93 93 0442... Nummer anzeigen 044 295 93 93 044 295 93 93 * -
 Zürich
ZürichKonditorei Berner GmbH
Hottingerstrasse 33, 8032 ZürichKonditorei Berner GmbH wurde mit 4.9 von 5 Sternen bewertet4.91062 Bewetungen044 251 51 06 0442... Nummer anzeigen 044 251 51 06 044 251 51 06 *
Wie lange muss Roggensauerteigbrot im Backofen backen?
Die Zeit im Backofen ist natürlich je nach genauem Rezept, je nach Ofen und je nach Temperatur unterschiedlich, aber in der Regel liegt die Dauer zwischen 45 und 60 Minuten. Dabei wird nach etwa der Hälfte der Backzeit die Temperatur etwas reduziert, damit das Brot nicht zu hart wird. Während dem Backen kannst du eine Schüssel mit Wasser mit hineingeben, um ein saftigeres Ergebnis zu erhalten. Die Kruste reisst entweder selbst in wildem Muster auf oder wird durch vorherige Schnitte gezielt vorbereitet.
Ist Roggensauerteigbrot besser als Weizenbrot?
Bei der Zubereitung von Roggensauerteigbrot kommen in der Regel keine reinen Auszugsmehle oder Zusatzstoffe zum Einsatz. Dadurch entsteht ein kräftiges, ballaststoffreiches Brot, das im Unterschied zum Weizenbrot oder Weissbrot mehr Nährstoffe enthält und länger satt macht. Helles Weizenbrot sorgt häufiger für Heisshungerattacken und hält sich ausserdem oftmals nicht so lange frisch wie Roggensauerteigbrot. Dafür ist Roggenbrot beim Backen auf Sauerteig oder andere Helfer angewiesen.
Kann ich Roggensauerteigbrot im Kühlschrank aufbewahren?
Das Anstellgut, das zu Zubereitung eines Sauerteigs verwendet wird, hält sich im Kühlschrank etwa eine Woche. Die Temperatur sollte dabei etwa vier bis sechs Grad betragen. Vor der weiteren Verwendung des Anstellgutes oder Sauerteiges solltest du sie etwa zwei Stunden bei Zimmertemperatur aufwärmen lassen, damit die Inhaltsstoffe wieder zu arbeiten beginnen. Das Sauerteigbrot hingegen sollte nicht in den Kühlschrank wandern, sondern besser in einem Brotkasten oder Brottopf aufbewahrt werden. Wird Brot zu kühl gelagert, kann die enthaltene Stärke kristallisieren, was das Brot trocken und fade im Geschmack werden lässt.
Wie lange ist Roggensauerteigbrot haltbar?
Industriell gefertigtes Brot oder helles Weissbrot bekommt meist schon nach wenigen Tagen eine trockene Konsistenz und einen eher faden Geschmack. Hier zeigt sich ein grosser Vorteil der Sauerteigbrote, die durch ihre Inhaltsstoffe und Zubereitungsart die Feuchtigkeit besser speichern können. Bei der Lagerung solltest du ausserdem auf Papiertüten verzichten, die dem Brot die Feuchtigkeit schneller entziehen. Und zu guter Letzt ist nicht nur der Sauerteig, sondern auch der Roggen als Hauptzutat einer der Gründe, warum das Roggensauerteigbrot länger frisch bleibt. Schliesslich kann Roggen im Unterschied zu Weizen ebenfalls besser Wasser speichern und trägt damit seinen Teil dazu bei, warum Sauerteigbrot aus Roggenmehl so ein leckeres, bekömmliches und lange haltbares Lebensmittel ist.
Der Bäckereivergleich für die Schweiz. Finde die besten Bäcker in deiner Nähe - mit Preisen und Bewertungen!
Top Ortschaften mit Bäcker
Das könnte dich auch interessieren
Zopfteig einfrieren: Schritt für Schritt zu einem leckeren Hefezopf
Ob als süsser Sonntagszopf bestrichen mit Butter oder Marmelade oder als deftige Mahlzeit, als Speckzopf – ein Hefezopf ist eine beliebte und vielfältige Backware für viele Anlässe. Einen Hefezopf kannst du dabei auch auf Vorrat herstellen, einfrieren und bei Bedarf einfach wieder auftauen und dann ofenfrisch backen. Besonders gut schmeckt der Zopf, wenn du den geformten Hefeteig noch ungebacken einfrierst. Im folgenden Ratgeber erhältst du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Zubereitung und zum Einfrieren eines Hefezopfteigs. Ausserdem geben wir dir Tipps, wie du einen eingefrorenen Hefeteig wieder auftaust und backst.
Schokoladenganache – die leckere Creme für Torten und Kuchen
Ein schmackhafter Kuchen oder eine Torte sollten nicht nur den Gaumen erfreuen, sondern auch optisch eine Wirkung erzielen. Sehr schön wirken Dekorationen aus Streusel, Schokoladensplittern oder Zucker. Damit solche dekorativen Elemente halten, wird gerne eine Schokoladenganache gemacht, die als feste Basis dient und gleichzeitig lecker schmeckt. Was das ist und wie ihre Herstellung funktioniert, erfährst du hier.
Brot – Kohlenhydrate und Nährwert: Gesundheit hängt von der Ernährung ab
Viele Diäten bauen auf das Low-Carb-Prinzip, bei der weniger Kohlenhydrate und mehr Protein das Abnehmen erleichtert. Proteine machen tatsächlich satt, doch die dabei stattfindende Umstellung des Körpers in die Ketose ist auch eine Belastung für ihn. Dazu empfinden viele Menschen den Verzicht auf Kohlenhydrate als schwierig, besonders wenn es um Brot geht. Eine ausgewogene Ernährung macht mehr Sinn – denn es gibt auch Brotsorten, die beim Abnehmen helfen.
Sauerteig Anstellgut: Infos und Tipps für die Herstellung der Basis eines guten Brots
Der Duft eines frisch gebackenen Sauerteigbrotes ist verführerisch. Auch mit seinem Geschmack und seiner Konsistenz punktet ein handwerklich hergestelltes Sauerteigbrot. Verantwortlich dafür ist vor allem die Basis eines jeden Sauerteigs – das Anstellgut. Ein Sauerteigbrot kann immer nur so gut schmecken wie seine Sauerteigkultur. Diese selbst herzustellen, ist gar nicht so schwierig, wie viele Menschen denken. Welche Zutaten du für das Anstellgut eines Sauerteigs brauchst, wie du es zubereitest und was du dabei beachten solltest, erfährst du in unserem Ratgeber. Ausserdem geben wir dir Tipps zur Pflege und Weiterverarbeitung des Anstellguts.
Mehl Typ 405: Vielseitig einsetzbar zum Kochen und Backen
Hast du auch schon einmal vor dem Lebensmittelregal im Supermarkt gestanden und dich gewundert, wie viele verschiedene Mehltypen es eigentlich gibt? Sicher ist dir aufgefallen, dass Weizenmehr besonders häufig vorkommt. Doch auch Roggen- oder Dinkelmehl findest du im heimischen Supermarkt. Aber was hat es eigentlich mit den Nummern auf der Mehltüte auf sich? Einige wichtige Grundkenntnisse zum Thema Mehl solltest du haben, denn nur so kannst du die geeignete Sorte für die Herstellung deiner Backwaren verwenden. Alles zum Mehl Typ 405 erfährst du hier.
Roggenschrot: die gesunde Alternative zum Mehl beim Backen
Ein gesundes und ballaststoffreiches Brot, das lange sättigt, kannst du als Alternative zum Mehl auch mit Roggenschrot herstellen. Aber was ist Roggenschrot eigentlich? Worin unterscheidet es sich von Roggenmehl und wofür kann es verwendet werden? Antworten auf diese Frage erhältst du in folgendem Ratgeber. Ausserdem haben wir ein schmackhaftes Rezept mit einer ausführlichen Anleitung für ein Roggenschrot-Brot ausgewählt.

